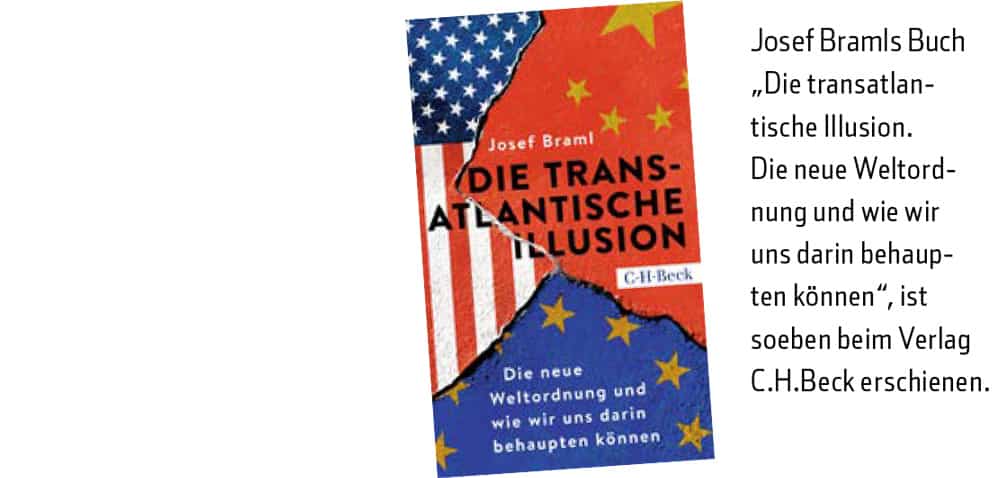Mehrfrontenkrise
Die Ohnmacht des „Westens“ bei der Bewältigung multipler Krisen
Die Ohnmacht des „Westens“ bei der Bewältigung multipler Krisen
Die Ohnmacht des „Westens“ bei der Bewältigung multipler Krisen
Eine nach wie vor nicht bewältigte COVID-19-Pandemie, stockende Produktion wegen unterbrochener Lieferketten, Unsicherheit bei der Energieversorgung, eine damit befeuerte Inflation und nun auch noch ein Krieg mitten im Herzen Europas sind nur einige bereits sichtbare Krisenphänomene. Sie überfordern die Handlungsfähigkeit des sogenannten Westens, der sich nichtsdestotrotz rhetorisch einen epochalen Feldzug der guten Demokratien gegen die bösen Autokraten auf die Fahnen geschrieben hat.
Angesichts der dramatischen Kriegsbilder aus der Ukraine sind westliche Regierungen nun umso mehr zum Handeln aufgerufen. Aus guten Gründen lehnen sie jedoch eine direkte Kriegsbeteiligung und militärische Konfrontation mit Russland ab. Stattdessen werden Waffen geliefert und härtere Wirtschaftssanktionen in Stellung gebracht. Damit soll angeblich der „Preis“ für Putins militärischen Angriff hochgetrieben und das Verhalten der Machthaber im Kreml verändert, wenn nicht sogar ein Regimewechsel in Moskau bewirkt werden.
Während ihre Wirksamkeit noch auf sich warten lässt, zeitigen Sanktionen bereits Kollateralschäden, auch für die eigenen westlichen Wirtschaften. Sanktionen, vor allem jene im Energiebereich, sind ein zweischneidiges Schwert. Sie verursachen auch höhere (politische) Kosten für westliche Volkswirtschaften. Selbst der Präsident der vermeintlich energieunabhängigen USA könnte bereits bei den Kongresswahlen im Herbst den politischen Preis für die von ihm nicht kontrollierbaren hohen Energiekosten bezahlen. Die auch durch hohe Energiepreise getriebene Inflation und wirtschaftlichen Probleme erhöhen die Chance auf einen Wahlsieg der Republikaner. Mit dem Verlust der Mehrheit in einer oder vielleicht sogar beiden Kammern des Kongresses würde der amtierende US-Präsident Joe Biden endgültig seine innenpolitische Handlungsfähigkeit einbüßen. Washingtons Politikblockade und Bidens Unfähigkeit, das Wahlrecht zu reformieren, spielen auch Donald Trump in die Karten, in zwei Jahren wieder ins Weiße Haus einzuziehen. Es ist durchaus möglich, dass Biden nur noch bis Ende 2024 an der Macht und bis dahin innenpolitisch eine lame duck bleibt.
Auch außenpolitisch wirkt der vermeintlich mächtigste Mann der Welt ohnmächtig – und ist auf das Wohlwollen autokratischer Potentaten, etwa Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman angewiesen, den der US-Präsident ebenso verachtet wie Putin. Noch im Wahlkampf wollte Biden den saudischen Kronprinzen wegen dessen Beauftragung des grausamen Mordes an dem Journalisten Jamal Khashoggi als „Paria“ an den Pranger der Weltöffentlichkeit stellen. Wegen der Folgen seines Ölembargos gegen Russland ist Biden jedoch nun umso mehr auf die Hilfe des einzigen „Swing Producers“ Saudi-Arabien angewiesen, um die Energiepreise wieder zu reduzieren und damit auch die Inflation einzudämmen.
Schon heute bereitet die Inflation – und nicht der Krieg im weit entfernten Europa – den Amerikanerinnen und Amerikanern die meisten Sorgen. Deshalb sind sie auch insgesamt pessimistischer hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Erwartungen geworden. Drei Viertel der US-Bevölkerung gehen davon aus, dass sich ihre wirtschaftliche Lage weiter verschlechtert.
Um die Inflation einzudämmen, müsste der US-Präsident auch einen – innenpolitisch umso schwieriger zu vermittelnden – Waffenstillstand im Wirtschaftskrieg mit Chinas Führer Xi Jinping vereinbaren. Denn auch Washingtons Strafzölle gegen das Reich der Mitte haben preistreibend gewirkt. Und welche Konsequenzen die beabsichtigte weitere „Entkoppelung“ westlicher Volkswirtschaften von China kurz- und mittelfristig hätte, konnte man in Ansätzen bereits im Zuge der COVID-19-Krise besichtigen. Als zu Beginn der Pandemie die Container aus China ausblieben, fehlten schnell wichtige Grundstoffe und Alltagsprodukte, auf denen eben allzu oft „Made in China“ steht. Und als die Wirtschaft langsam wieder in Gang kam, führten die nach wie vor gestörten Lieferketten zu erheblichen Nachschubproblemen – und zu Inflation.
Die westlichen Staaten haben ihre Geldmenge in den vergangenen Jahren drastisch ausgedehnt. Das lief ohne hohe Inflationsraten ab, weil es eine große Warenelastizität gab: Die amerikanische Notenbank (Fed, kurz für Federal Reserve) und die Europäische Zentralbank (EZB) konnten gar nicht so viel Geld drucken, als dass dem durch Produktionssteigerungen nicht ein entsprechendes Warenangebot hätte gegenübergestellt werden können. Wo das nicht ging, etwa bei Immobilien, schossen die Preise in die Höhe. Würde man jetzt im Sinne Washingtons eine weitere Entflechtung westlicher Volkswirtschaften von China anstreben, würde diese Elastizität erheblich verringert. Die Folge wären dauerhaft hohe Inflationsraten, also ein Spiel mit dem Feuer.
Angesichts des steigenden Preisdrucks können bereits heute die Verantwortlichen westlicher Notenbanken die Inflation nicht mehr ignorieren und als „temporär“ abtun. Doch die Gelddrucker sind in einem Dilemma, der Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik ist heikel: Indem die Fed und EZB bereits seit der Wirtschafts- und Finanzkrise 2007/2008 mit unvorstellbaren Summen Liquidität zur Verfügung gestellt und damit die Zinsen niedrig gehalten haben, konnten sie bislang eine Kernschmelze im Banken- und Finanzsystem verhindern.
Wenn die US-Notenbank nun wie angekündigt anstelle ihrer bisherigen „quantitativen Lockerung“ weniger Anleihen und Kredite aufkaufte und den Leitzins, die Federal Funds Rate, erhöhte, würden US-Unternehmen, die mit dem billigen Geld noch mehr oder weniger gut über die Runden kommen, in große finanzielle Schwierigkeiten geraten. Zudem könnte ein erhöhtes Zinsniveau bei privaten Kreditnehmern einen „Zahlungsschock“ auslösen, wenn der höhere Zinssatz die Rückzahlungslast spürbar erhöht. Sollte die in vielen US-Haushalten wegen der Pandemie und den hohen Energiepreisen zusätzlich angespannte wirtschaftliche Lage noch durch Zinserhöhungen verschlechtert werden, würden wieder in größerem Ausmaß Kredite notleidend werden. Und das würde einmal mehr die Gefahr einer Immobilien- und damit Finanzkrise heraufbeschwören.
Doch dieser C(r)ash-Kurs wird trotz gegenteiliger Verlautbarungen der Notenbanken wohl oder übel weitergeführt werden müssen. Denn auch westliche Staaten würden angesichts der ohnehin schon atemberaubenden Schuldenberge durch höhere Zinsen noch schneller die bereits drohende Handlungsunfähigkeit erreichen.